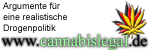|
Illegale Drogen in Rußland
Ein allumfassendes Schadensminderungsprogramm oder "the
war on drugs"?
0. Notwendige Einführung
Anfang der 70-er galt das Drogenabhängigkeitsproblem in der Sowjetunion als nicht besonders wichtig oder gefährlich ausgenommen Alkoholismus. In einem Psychiatrielehrbuch aus dem Jahr 1971 zählt man Morphinismus, Haschischismus und Kokainismus (letzteren beschrieb man als "praktisch nicht vorhanden"). Aber man hat das Erwünschte für das Wirkliche ausgegeben. Mitte der 70-er ist der Drogenkonsum in vielen Regionen des Landes ziemlich gewöhnlich, aber gesellschaftlich nicht anerkannt geworden. Und seit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen nach Afghanistan hat sich der bis heute funktionierende Drogenhandelsweg gebildet. An der Grenze der 80-90-er Jahrzehnte ist die sogenannte "Drogenrevolution", zusammengetroffen mit "Perestroika" und "Glasnost" von Gorbatschow. Heute nennt man oft diese Periode, so ungefähr zwischen 1987 und 1994, "unsere kleinen 60-er". Dazu gab es noch einen Moment, der die Bevölkerung zum Drogenkonsum bewegte, und zwar diese berühmte "Gegenalkoholkampagne" von Gorbatschow. Die Begrenzung für Alkoholverkauf hat eine Art "Substitutionstherapie" provoziert: die Jugendlichen haben Experimente mit psychoaktiven Mitteln angefangen. Und die offene Grenze hat nicht nur zur Entwicklung einer offeneren Gesellschaft, sondern auch zur Entwicklung des illegale Drogengeschäftes beigetragen. 1994 ist der Bruch passiert: der sogenannte "Vint" (ein Schraube), ein zu Hause an der Küche gekochtes Ersatzpervitin, war nicht mehr die verbreitetste Droge in Rußland (Ukraine, Weißrußland etc.), sondern Heroin. Und Rußland selbst hat sich vom Transitterritorium zum Konsumterritorium gewandelt. Zur Zeit schwanken die Preise für einen "chek" Heroin (bis zu 0,5 gr versetzter Droge) in verschiedenen Bundesländer zwischen 50 und 150 Rubel (4-11,5 DM). Die Hauptlieferung, offizieller Meinung nach, kommt aus Afghanistan über Tadschikistan und Kasachstan, aber auf dem Schwarzmarkt kann man verschiedene Sorte finden, so wie "weißer Chinese" (ein synthetisches Opiat) u.a. Die Qualität von diesen "Strassendrogen" ist sehr schlecht bis zu 90% Beimischungen. Eng verbunden mit der Heroinexpansion ist auch die schnelle Verbreitung von HIV und Hepatitis.
1. Zeitgenössische Drogensituation
Seit der Jahrzehntenwende
(80-90) hatten wir ein relativ liberales "Bundesdrogengesetz" (Federalnij
zakon o narkotitscheskich sredstvach), wo es einen deutlichen Unterschied zwischen
Drogenkonsumierenden und Drogenhändlern gab (das heißt, Drogenkonsum
war außer Strafe). Der Unterschied wurde durch eine spezielle Tabelle
befestigt, deren Titel man so ungefähr als "Sammeltabelle der Schlussfolgerungen
des Ständigen Drogenkontrollkomitees (weiter PKKN) über Zurechnen
zu geringen, großen und besonders großen Massen der Zahlen der Rauschmittel...,
die in illegaler Verwahrung oder im Umlauf entdeckt worden sind" ins Deutsch
übersetzen kann. Dieser überlange verbürokratisierte Titel zeigt
die wirkliche Wichtigkeit der Tabelle: mit ihr hat man die Größe
der Strafe, die bis zum 15 Jahre Knast hoch sein könnte, festgestellt.
In der Umgangssprache nennt man sie einfach "Die (oder Unsere) Tabelle".
Seit 1998 gibt es ein neues, viel repressiveres Gesetz. Obwohl der Drogenkonsum
bis heute straflos zu sein scheint, hat man in Wirklichkeit die oben beschriebene
Tabelle stark verändert. Z.B. für Heroin haben wir jetzt überhaupt
keine "geringe Menge", und "besonders groß" ist schon
mehr als 0,005 gr (was eigentlich viel weniger als eine handelsübliche
Einheit ist (ca. 0,5 gr.). Der Leiter des PKKN, der 81-jährige Akademiker
Eduard Babayan, ist als harter Anhänger der Repression für Drogenkonsumenten
und radikaler Feind jeder Entkriminalisierungsidee bekannt. Er stimmt in allen
Fragen mit den Repressionsbehörden überein. Seine Logik ist schwer
wie einen Bleisarg: die Drogen sind in unserem Land verboten, offiziell hat
man die nicht produziert, nicht geliefert und nicht verkauft, das heißt
jede Operation mit denen wird automatisch illegal, das heißt jede Menge
ist kriminell.
Nach Offiziellen Information gibt es zur Zeit in Rußland rund 500.000
Menschen mit der Diagnose "Drogenabhängigkeit". Die Experten
aber bieten diese Zahl um 5-10 Mal vergrößern an. Und parallel mit
der Brutalität des Gesetztes wachst auch die Zahl der HIV-Positiven. Wenn
seit 1987 (erste HIV-Infektion) pro Jahr nicht mehr als 1000 HIV-Positive registriert
werden, die meistens durch Geschlechtsverkehr oder über Blut infiziert
worden sind, dann beginnt ab 1996 die echte Epidemie unter den Fixern. Im Jahr
1994 wurden nur 2 Fälle registriert, die mit Sicherheit über Drogenspritzen
infiziert worden sind. Allein im Jahr 1999 aber sind rund 14.980 HIV-Positive
(3,5 Mal mehr als vor einem Jahr) dazugekommen; jetzt gab es im Lande schon
25.842 HIV-positive Menschen, 15.000 von denen infizierte Fixer. Im Jahr
2000 gab es schon 80.000 HIV-Positive, 50% von denen - infizierte Fixer. Mai
2001: staatliches Sanitätsepidemieamt berichtet über 113.323 HIV-Positive,
10% sind Kinder, 90% - Fixer. Die Experten der Weltgesundheitsorganisation meinen,
dass sich die wirkliche Zahl der HIV-Infizierten auch um 5-10 Mal vergrößern
wird. Die Geschwindigkeit der HIV-Verbreitung ist leider z.Z. in Russland die
schnellste in der Welt. Besonders schwierig ist die Situation wegen einer neuen
Ergänzung (seit Juni 2000) zum Pressegesetz (Zakon o sredstvach massovoj
informatsii), die Drogenpropaganda verbietet. Es ist so formuliert, dass der
Vergleich zwischen Heroin und Cannabis und die Information über deren verschiedenen
Wirkungen schon als Propaganda gilt ("Propaganda irgendwelcher Vorzüge
gegenüber einzelnen Rauschmitteln")... De facto arbeitet die Ergänzung
nicht, weil man bis heute noch keine Strafe dazu eingeführt hat. Im Sommer
dieses Jahres ist die Situation aber schlechter geworden. Die Prohibitionslobby
wurde aktiviert, die große Gegendrogenwerbungskampagne des Presseministeriums
begann, zur Leitung des Drogenarztamtes sind neue Leute gekommen, die offenbar
repressive Ideologie mitgebracht haben. Und es scheint so zu sein, dass sehr
bald der Drogenkonsum doch strafbar sein wird, und die Informationsarbeit der
Schadensminimierungsprojekte verboten wird.
2. Russische Initiative der Schadensminimierung
Seit Mitte der
90-er ist in Rußland "Ärzte ohne Grenzen"-Holland (MSF)
im Bereich der HIV-Prävention tätig. Nach dem von ihnen durchgeführten
Monitoring der Situation haben sie sich an das Gesundheitsministerium mit der
Warnung über drohende HIV-Verschlechterung gewandt. Es wurde ein gemeinsames
Memorandum unterschrieben, danach durfte MSF offiziell ein HIV-Prophylaxetraining
für russische Spezialisten durchführen. Ein besonderer Akzent wurde
auf die Kontaktarbeit mit den Spritzdrogenkonsumenten gelegt, und solche Arbeit
sollte von Anfang an nach dem Modell der Schadensminimierung, d.h. als harm
reduction programm, aufgebaut werden. Ab 1997 wird in Moskau und später
auch in verschiedenen Regionen die HIV-Präventionstätigkeit bei Drogenkonsumenten
sowohl durch staatliche (vor allem medizinischen wie z.B. AIDS-Center) als auch
nichtstaatlichen (wie z.B. Wohltätigkeitsstiftung "Wozvraschenije"-Rückkehr
in SPb) Organisationen angefangen. Vor allen Dingen ist die Russische Initiative
für Schadensminimierung (bei nichtmedizinischem Drogenkonsum) dabei. Dieses
Projekt wurde auch von MSF-Holland gegründet und fast 5 Jahre lang finanziert.
Einige Zeit haben sie auch praktische Arbeit mit Straßenfixern und prostituierten
Frauen in Moskau und Umgebung gemacht. Fast 3 Jahre wurden aber solche Programme
auf einem halblegalen Grund durchgeführt. Im Dezember 1999 hat der Hauptsanitätsarzt
der Russischen Föderation Gennadij Onischenko "Die Verordnung für
dringende Maßnahmen gegen HIV-Verbreitung" veröffentlicht, wo
er auf ein besonderer Nutzen von Schadensminimierungsprogrammen in Sankt-Petersburg
und Kaliningrad hingewiesen hat. Diese Verordnung hat einen gewissen Optimismus
ausgelöst. Zu dieser Zeit gab es etwa 30 Schadensminimierungsprojekte in
ganz Rußland, und heute sind es schon mehr als 50. Sie machen vor allem
medizinische und juristische Beratung sowohl an stationären als auch an
mobilen Stellen, auch Informationsarbeit auf der verdeckten Drogenszene durch
freiwillige Volontäre und speziell vorberatene Sozialarbeiter, dazu noch
Spritzenaustausch (aber nicht in Moskau solche Dinge sind da von Anfang
an und bis heute verboten; der Moskauer Bürgermeister Juri Luschkov ist
als einer der Verfechtern der Todesstrafe für Drogenhandel bekannt und
von der Idee der Schadensminimierung nicht begeistert). Also haben an den Lehrtrainings
von MSF die Vertreter mehr als 60 Regionen teilgenommen (und HIV-Ausbruch wurde
in 86 von 89 russischen Bundesländern registriert). Die regionalen Projekte
werden meistens vom Institut „Eine offene Gesellschaft“ (George Soros
Foundation-USA) finanziert. Noch ein Beispiel für eine relativ große
Organisation, die in diesem Gebiet tätig ist, ist die Wohltätigkeitsstiftung
"Weg mit den Alkoholismus und Drogenabhängigkeit" (NAN) von Kindersuchtmediziner
Oleg Zikov. NAN hat etwa 50 Regionalabteilungen und konzentriert sich vor allem
auf sogenannte sekundäre Drogenprävention für Kinder und Halbwüchsige.
Dr. Zikov ist praktisch ein Vertreter für die Schadensminimierung, aber
er meidet öffentliche Aussagen zu diesem Thema. Trotzdem sagt er oft, dass
es in der Arbeit solcher Art ohne Mitarbeiter, die sogenannte "ehemalige
Konsumenten" sind, nicht weitergeht. Im südwestlichen administrativen
Bezirk von Moskau wurde z.B. auch das Straßenarbeitsprojekt "Jasen"
("Esche") von der NAN gegründet, welcher z.Z. unabhängig
von der NAN funktioniert und auch von der Soros Foundation finanziell unterstützt
wird.
Das ursprüngliche MSF-Schadensminimierungsprojekt gibt es nicht mehr: es
hat sich in drei autonome Organisationen geteilt. Diese kleinen Vereine sind
eigentlich das Straßenarbeitsprojekt selbst, die Selbstorganisation der
Drogenkonsumenten "Der Brunnen" (Kolodets) und die Wohltätigkeitsstiftung
"Für eine gesunde Gesellschaft" (Fonds 330). Alle drei haben
z.Z. keine grundsätzliche Finanzierung.
3. Zurück zum LTP-System: die neue Gegendrogenkampagne
Das Hauptstraforgan in diesem Bereich ist z.Z. die Verwaltung für den Kampf gegen illegalen Drogenumlauf (UBNON), vom Generalleutnant Alexander Sergeev geleitet. UBNON legt sich für "War-on-drugs"-Politik ins Zeug. Im Jahr 1998, als die ersten Spritzenaustauschprogramme im Lande eingeführt worden sind, hat der General einen Brief zum Gesundheitsministerium geschickt, wo er behauptete, dass solche Programme "für Rußland mehr Schaden, als Nutzen bringen werden" und "von dem gesunden Teil der Bevölkerung für moralisch-ökologische Intervention, welche nationalsicherheitsgefährlich ist, betrachtet wird". Seine Position unterstützt heute im wesentlichen das wissenschaftliche Forschungsinstitut für Suchtmedizin (NII Narkologii). Beide Leiter des Institutes Nikolai Ivahets und Alexei Nadezdin sind im August 2001 Hauptsuchtmediziner bzw. Hauptkindersuchtmediziner der RF geworden. Und der zweite Posten wird kennzeichnend speziell für Dr. Nadezdin "in die Nomenklatur eingeführt". "Die Zerstörung der traditionellen kulturellen Werten und aggressives Eindringen der westlichen liberalen Ideologie halte ich für die Hauptursache der Verbreitung der Drogensüchtigkeit im Kinder-Halbwüchsige-Jugendlichemilieu", - so spricht der Arzt und ruft nach Wiedereinführung des LTP-Systems (arbeitstherapeutische Entwöhnungsanstalt), das vor 10 Jahren auf dem ganzen sovietischen Gebiet als strafepsychiatrisch geschlossen wurde. "Doch wir hatten damals in der USSR rund 70.000 funktionierende Krankenhausbetten, - sagt Nadezdin, - ...und 70% der Menschen, die durch LTP gegangen sind, sind dorthin nie mehr zurückgekommen... sie haben sich danach schon ziemlich gut benommen". Im Sommer 2001 hat sich eine stürmische Diskussion über die Todesstrafe für Drogendealer entwickelt. Im Laufe der Gouverneurwahlkampagne in Niznij Novgorod hat der Kandidat Dmitrij Saveliev zusammen mit der Parlamentsabgeordneten Vera Lekareva (beide vom Bündnis des Rechten Kräften - SPS) mehr als eine Million Unterschriften dafür gesammelt. Später haben die Leiter von der SPS-Partei, die eigentlich als liberal gilt, diese Unterschriftensammlung als private Initiative von beiden Politikern und nicht als Parteiinitiative bezeichnet. Und noch später hat der Präsident Putin in seinem TV-Auftritt deutlich gesagt, dass die Todesstrafe in Rußland überhaupt unmöglich ist. Trotzalledem machen die Verfechter für Todesstrafe auch heute ganz öffentlich solche provokativen und populistischen Erklärungen. Und im Oktober in Ekaterinburg gab es ein Treffen der Vertreter von vier religiösen Konfessionen, und zwar der orthodoxen, katholischen, jüdischen und muslimischen. In ihrer zusammen unterschriebenen Eingabe steht unter anderem: "Die Legalisierung der Prostitution, die "safer-sex" Propaganda, die Austeilung von Kondomen an Halbwüchsige, die Methadontherapie für Drogensüchtige und die Eröffnung der Spritzenaustauschstellen, das alles im Rahmen des spitzbübischen "Schadensminimierungprogrammes" angeboten, werden eindeutig negative Wirkung auf die Situation haben, und davon sind wir durchdrungen". Was die russischen Journalisten betrifft, diese haben eigentlich meistens nur schlechte Vorbereitung und tendenziöses Herangehen bei der Beschreibung des Problems gezeigt. Der einzige Erfolg ist, daß in der Gesellschaft ein unheimliches Bild von Drogenkonsumenten als Volksfeinde, Infektionsträger und Abschaum erzeugt wurde. So ein Herangehen haben vielmals verschiedene Politiker, Drogenärzte, kulturelle und öffentliche Persönlichkeiten demonstriert. Viele von denen sind ganz mit den Milizisten solidarisch, da sie ihre Blicke auf Drogenkonsumenten wie auf Kriminellen werfen. Und wenn HIV-Infizierte gesellschaftlicherweise stutzige-wehleidig, dann "diese böse Drogensüchtigen" ausschließlich negativ angenommen werden. So ist es nicht erstaunlich, dass Drogenkonsumenten (besonders Spritzen- oder Injektionsabhängige) dieses dämonenhafte Image selbst anerkennen und sich als desozialisiert, vergessen, unrettbar und nichtsnutzig wahrnehmen.
4. Zum Schluss
Am 26 Oktober
2001 hat in Moskau eine öffentliche Parlamentsanhörung zum Thema "Der
illegale Drogenumlauf die Bedrohung der Nationalsicherheit und der territorialen
Integrität Rußlands" stattgefunden. "Man erkennt eine schlechte
Tendenz der Auswechslung (besonders primärer) Drogensuchtprävention
mit sozial-ökonomischen Maßnahmen gegen die Doktrin der Schadensminimierung
bei der Einnahme der illegalen Drogen" solche Schlussfolgerung haben
die Teilnehmer der Anhörungen gemacht. Und sie haben sofort "eine
neue Konzeption der staatlichen Drogenpolitik in diesem Bereich für die
Jahren 2002-2006" angekündigt.
Es gibt allen Grund zu befürchten, daß in dieser Konzeption als Grundlage
das amerikanische "war-on-drugs"-Modell hergenommen wird, aber für
das "spitzbübische Schadensminimierungsprogramm" kaum irgendein Platz
reserviert wird.
Alexander Smirnov
(Delphinoff, delphinoff@mail.ru)
Redakteur der Schadensminimierungszeitschrift m03g (Fonds 330)
Moskau, November 2001